Besonderer Buchtipp: Apeirogon von Colum McCann
Besonderer Buchtipp:
Apeirogon von Colum McCann
Rami und Bassam sind Freunde und wohnen im selben Land nah beieinander. Und doch leben sie in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Denn das Land ist Israel und Rami ist Jude, Bassam Palästinenser. Was sie verbindet, ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann – beide haben ein Kind bei einer Gewalttat verloren.
Dennoch fordern sie keine Rache, sondern halten gemeinsam Vorträge darüber, dass nur Kommunikation und ein Verständnis für den anderen zu einem Frieden im Nahen Osten führen können.
Das Buch erschien bereits 2020 und ist doch aktueller denn je.
Wir stellen den Roman und den Autor ausführlich vor. Zusätzlich gibt es passende Diskussionsfragen für eine Besprechung im Lesekreis.
Rosa und Leo: Die große Liebe der Rosa Luxemburg von Charlotte Roth
Entdeckung des Monats:
Rosa und Leo: Die große Liebe der Rosa Luxemburg von Charlotte Roth
Rosa Luxemburg war eine Vordenkerin und Freiheitskämpferin. Über ihr Privatleben ist jedoch wenig bekannt.
Dieser biografische Roman erzählt neben ihrem politischen Weg und einem Porträt der damaligen Zeit, auch von der großen, dramatischen Liebesgeschichte zwischen der Revolutionärin und Leo Jogiches.
Charlotte Roth hat zahlreiche Romane über Frauenschicksale veröffentlicht, die meist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte spielen.
Wir stellen den Roman und die Autorin ausführlich vor, inklusive Interview zum Roman und Diskussionsfragen für Lesekreise.
Unser Thema des Monats: Das Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen
Unser Thema des Monats:
22 Bahnen von Caroline Wahl ist Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen
Seit 2015 küren die unabhängigen Buchhandlungen ihr Lieblingsbuch.
Die Nominierten für 2023 waren:
Elena Fischer: „Paradise Garden“
Milena Michiko Flašar: „Oben Erde, unten Himmel“
Rónán Hession: „Leonard und Paul“
Jarka Kubsova: „Marschlande“
*Caroline Wahl: „22 Bahnen“ (Lieblingsbuch)Wir haben alle bisherigen Gewinner und die 5 Romane der Shortlist zusammengestellt – insgesamt 45 Buchtipps! Und zu vielen davon gibt es bereits Diskussionsfragen.
Umfrage
Anzeige
Die Geschichte einer heimlichen Heldin
Wie kann es sein, dass Mütter im Nachkriegsdeutschland aus Not ihre Babys aussetzen? Die Hebamme Henni hat die Idee zu einer Babyklappe. Ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte berührend erzählt.
» Leseprobe + Diskussionsfragen
FOLGEN SIE dem Droemer Verlag
Anzeige
Kerstin Hämke, Gründerin von Mein-Literaturkreis.de, zeigt, warum das gemeinsame Lesen so viel Spaß macht und gibt viele praktische Tipps. Zusätzlich: 50 Buchtipps, die sich besonders für eine Diskussion eignen.
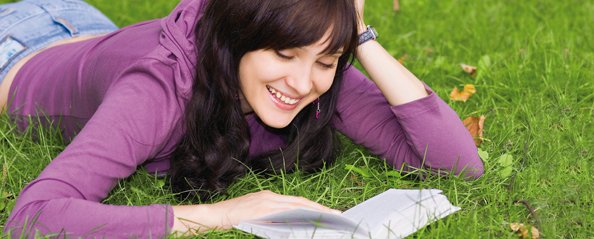
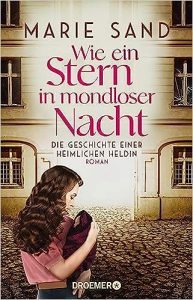
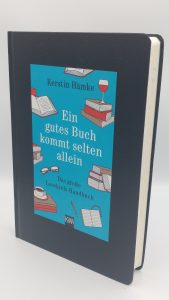
Rachel Givney
Das verschlossene Zimmer
0
Kaufen mit einem Klick: » Lieblingsbuchhandlung » bei Amazon kaufen » bei Thalia kaufen » bei Borromedien kaufen
Unsere Neuentdeckung des Monats
Wir haben drei Buchpakete mit mehreren Exemplaren des Buches an Lesekreise verlost.
Leseprobe
Über Rachel Givney
Die Australierin Rachel Givney arbeitet als Drehbuchautorin für TV-Serien. Als Autorin wurde sie durch ihren ersten Roman, der Jane-Austen-Komödie ‚Janet in Love‘, bekannt, die momentan verfilmt wird. Givney hat polnische Wurzeln und liebt Krakau. Dies und die komplexe Geschichte des Landes hat sie zu ihrem zweiten Roman ‚Das verschlossene Zimmer‘ inspiriert.
Webseite der Autorin: www.rachelgivney.com
Zusammenarbeit mit dem Lübbe Verlag
Im Rahmen einer bezahlten Zusammenarbeit mit dem Lübbe Verlag, in dem der Roman erscheint, haben wir nachfolgend Diskussionsfragen zum Buch sowie ausführliche Hintergrundinformationen zusammengestellt. Diese umfassen u.a. die historische Einordnung sowie Informationen zu den Städten Krakau und Lemberg, in denen der Roman spielt. Weitere Informationen zu dieser Zusammenarbeit finden Sie hier.
Weitere Informationen zum Roman
Auf der Webseite des Verlags findet sich ein ausführliches Interview mit Rachel Givney zum Buch – sehr empfehlenswert!
Der Roman alterniert zwischen der (heute) polnische Stadt Krakau und Lemberg, das heute zur Ukraine gehört.
Krakau ist mit fast 800.000 Einwohnern nach Warschau die zweitgrößte Stadt Polens. Die Stadt hat sich zu einem bedeutenden Kultur-, Kunst- und Wissenschaftszentrum entwickelt. Krakau beheimatet die – nach Prag – zweitälteste mitteleuropäische Universität. Die Bausubstanz Krakaus ist trotz des Zweiten Weltkriegs weitgehend erhalten, da die deutsche Armee die Stadt im Januar 1945 kampflos verließ, als die russische Rote Armee von Osten kam.
Heute stehen die Altstadt, der Stadtteil Kazimierz sowie der Wawel auf der Liste der Unesco-Welterbe. Der Wawel ist ein Hügel im Zentrum, auf dem sich die Burganlage der ehemaligen Residenz der polnischen Könige und die Kathedrale befinden. Dort war auch der Sitz des Erzbischofs von Krakau, Karol Wojtyła, von 1978 – 2005 Papst Johannes Paul II. Kazimierz war das kulturellen und religiösen Zentrum der Juden in Polen. Heute ist es ein beliebtes touristisches Ziel, vor allem, da Steven Spielberg Teile seines Holocaust-Films Schindlers Liste dort filmte.
Lemberg (Lwiw) hat heute rund 730.000 Einwohner und eine wechselvolle Geschichte hinter sich. In den letzten Jahrhunderten gehörte es erst zu Polen, von 1772–1918 zur österreichischen Habsburgermonarchie, dann bis 1939 wieder zu Polen, während des Zweiten Weltkriegs war es zunächst von der sowjetischen Armee besetzt, dann Teil des deutschen Generalgouvernements, ab 1945 war Lemberg Teil der Sowjetunion und seit 1991 gehört es zur Ukraine.
Die Bevölkerung war immer vom Zusammenleben mehrerer Ethnien geprägt. Bis ins 20. Jahrhundert gab es neben einer polnischen Bevölkerungsmehrheit einen großen Anteil an Juden und Ukrainern. Nach der ‚Westverschiebung Polens‘ (siehe unten) bestand Lembergs Bevölkerung überwiegend aus Ukrainern, daneben Russen, Weißrussen und Polen.
Die Altstadt ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und wird von Bauwerken der Renaissance, des Barocks, Klassizismus und Jugendstils beherrscht.
Historischer Hintergrund: Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch der deutschen Armee in Polen. Als unmittelbare Folge erklärten am 3. September 1939 Frankreich und das Vereinigte Königreich aufgrund ihrer Garantieerklärung für Polen dem Deutschen Reich den Krieg. Eine große Offensive der Westmächte blieb aber trotz der Zusagen gegenüber Polen aus. Krakau fiel kampflos, Polens Hauptstadt kapitulierte Ende September. Die meisten überlebenden polnischen Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft.
Deutschland und die Sowjetunion teilten Polen unter sich auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand eine ‚Westverschiebung‘ Polens statt. Ostpolen – auch Lemberg – gehörten dann zur Sowjetunion und 1,7 Millionen dort lebende Polen und Ukrainer wurden ermutigt und gezwungen aus ihrer Heimat umzusiedeln. Polen siedelten in die sogenannten ‚wiedergewonnenen Gebiete‘ um, die vorher unter anderem als Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien und Danzig zum Deutschen Reich gehört hatten. Die ursprünglich dort ansässige deutsche Bevölkerung war geflohen oder vertrieben worden. Ukrainer, die in West- oder Mittelpolen gelebt hatten, mussten in die Gebiete, die jetzt zur Sowjetunion gehörten. Krakau war von der Westverschiebung nicht betroffen, da es im Zentrum von Polen liegt.
Juden in Polen: In Polen bildeten Juden vor dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutende Minderheit mit einem regen religiösen Leben; in Krakau war fast ein Viertel der Bevölkerung jüdischen Glaubens, in Lemberg fast ein Drittel. Trotzdem kam es immer wieder zu Übergriffen oder Repressalien.
1939 gab es in Polen 3.460.000 polnische Bürger jüdischer Abstammung. Viele kamen in eines der polnischen Ghettos. Der überwiegende Teil wurde ermordet, größtenteils durch die Deutschen. Von den Überlebenden wanderten viele nach Israel aus. Mit dem Fall des Kommunismus 1989 erlebte das kulturelle, soziale und religiöse Leben der Juden in Polen eine Wiederbelebung. Dennoch ist ihre Zahl gering und es gibt eine überwiegend negative Einstellung zu Juden seitens der polnischen Bevölkerung. Detaillierte Informationen zur Geschichte der Juden in Polen finden sich hier.
Quellen: eigene Zusammenfassung auf Basis diverser Wikipedia-Artikel
Diskussionsfragen