ONLINE DISKUTIEREN:
UNSER FACEBOOK-LESECLUB
Ab 1. JUNI: +++ DSCHINNS VON FATMA AYDEMIR +++
Alle zwei Monate ein neues Buch diskutieren.
Neuentdeckung: Das ist Alise von Jon Fosse
Unsere Neuentdeckung:
Das ist Alise von Jon Fosse
Seit Jon Fosse 2023 den Literaturnobelpreis verliehen bekam, steht er bei Lesenden und Medien im Fokus. Der 1959 geborene Norweger war bisher, trotz zahlreicher Romane, vor allem als Dramatiker bekannt. Sein literarisches Werk zeichnet sich durch einen ungewöhnlichen Sprachstil sowie die Beschäftigung mit großen menschlichen Themen aus.
Zum Einstieg in Fosses Werk bietet sich seine 2003 veröffentlichte Novelle an. Auf nur 120 Seiten finden sich dort der Stil und die existentiellen Fragen des Menschseins, für die Fosse bekannt ist.
Wir stellen den Roman und den Autor vor, inklusive passender Diskussionsfragen.
Besonderer Buchtipp: Apeirogon von Colum McCann
Besonderer Buchtipp:
Apeirogon von Colum McCann
Rami und Bassam sind Freunde und wohnen im selben Land nah beieinander. Und doch leben sie in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Denn das Land ist Israel und Rami ist Jude, Bassam Palästinenser. Was sie verbindet, ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann – beide haben ein Kind bei einer Gewalttat verloren.
Dennoch fordern sie keine Rache, sondern halten gemeinsam Vorträge darüber, dass nur Kommunikation und ein Verständnis für den anderen zu einem Frieden im Nahen Osten führen können.
Das Buch erschien bereits 2020 und ist doch aktueller denn je.
Wir stellen den Roman und den Autor ausführlich vor. Zusätzlich gibt es passende Diskussionsfragen für eine Besprechung im Lesekreis.
Unser Thema des Monats: Das Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen
Unser Thema des Monats:
22 Bahnen von Caroline Wahl ist Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen
Seit 2015 küren die unabhängigen Buchhandlungen ihr Lieblingsbuch.
Die Nominierten für 2023 waren:
Elena Fischer: „Paradise Garden“
Milena Michiko Flašar: „Oben Erde, unten Himmel“
Rónán Hession: „Leonard und Paul“
Jarka Kubsova: „Marschlande“
*Caroline Wahl: „22 Bahnen“ (Lieblingsbuch)Wir haben alle bisherigen Gewinner und die 5 Romane der Shortlist zusammengestellt – insgesamt 45 Buchtipps! Und zu vielen davon gibt es bereits Diskussionsfragen.
Umfrage
Anzeige
Ein Epos voller Härte, Humor und Schönheit
Ein bildgewaltiges Panorama über das Georgien der 1970er Jahre bis in die Gegenwart. Tilman Spreckelsen, FAZ: »Babluani legt einen glänzenden, rasant erzählten und tieftraurigen Roman vor.«
FOLGEN SIE dem Verlag Voland & Quist
Anzeige
Kerstin Hämke, Gründerin von Mein-Literaturkreis.de, zeigt, warum das gemeinsame Lesen so viel Spaß macht und gibt viele praktische Tipps. Zusätzlich: 50 Buchtipps, die sich besonders für eine Diskussion eignen.
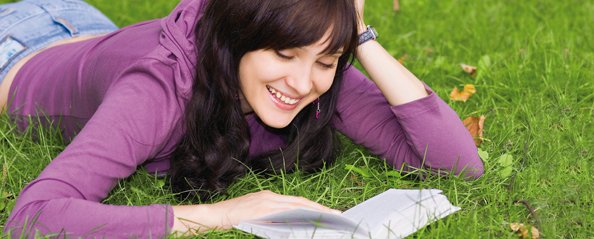
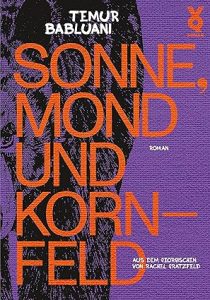
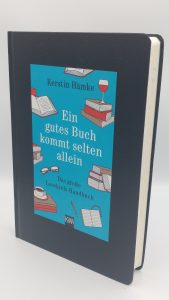
5 Fragen an Michaela Küpper zu ‚Die Edelweisspiratin‘
Ausführliche Informationen zum historischen Roman ‚Die Edelweisspiratin‘ von Michaela Küpper, inklusive Diskussionsfragen finden sich hier.
Wie haben Sie von den beiden Frauen, ihrem Leben und ihren politischen Aktivitäten erfahren?
In meinen beiden letzten Romanen hatte ich mich ja schon mit den Auswirkungen des Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg befasst.
Während der Recherchen stoße ich eigentlich immer schon auf weiterführende Themen, die ich gern aufgreifen würde. Dazu zählte auch der Widerstand. Diese Idee hatte ich also schon länger, aber es brauchte seine Zeit und auch Erfahrung, bis ich mich an das Thema herangetraut habe. Es war mir in gewisser Weise zu einfach, mich auf die Seite der „Guten“ zu stellen, man riskiert ja nichts mehr. Aber es sollte eben keine eindimensionale Geschichte werden und keine, die man schon kennt, wie etwa die der „Weißen Rose.“
So bin ich auf die Edelweißpiraten gestoßen. Weil ich aus der Region komme, war das für mich naheliegend, außerdem fand ich besonders interessant, dass diese Bewegung aus dem Arbeitermilieu stammte. Der Widerstand kam ansonsten ja eher aus intellektuellen Kreisen.
Was hat Sie an den Personen und der Zeit so fasziniert, dass Sie dies zu dem Thema eines Romans gemacht haben?
Die Geschichte der Gertrud ‚Mucki’ Kühlem ist für sich genommen schon faszinierend, aber der besondere Reiz lag für mich auch in ihrer Familiengeschichte: Der Vater Arbeiter und Kommunist, die Mutter Apothekerin – das war schon ziemlich ungewöhnlich.
Da ich gerne aus unterschiedlichen Perspektiven schreibe, drängte sich mir hier diese Erzählweise geradezu auf. Sowohl Mucki als auch ihre Mutter Gertrud waren ja zwei sehr starke Frauen, die im Grunde dieselben Ziele verfolgten, aber teilweise andere Mittel wählten. Es war spannend, das Geschehen einmal aus Muckis Jugendperspektive heraus zu erzählen und einmal aus der einer reiferen Frau, die anders aufs Leben blickt.
Welche der Personen im Roman würden Sie gerne einmal persönlich getroffen haben und was würden Sie sie fragen?
Oh, eigentlich alle! Natürlich wäre ich gern Mucki Koch noch persönlich begegnet, aber leider habe ich erst nach ihrem Tod mit der Recherche angefangen. Ganz besonders würde mich auch eine Begegnung mit ihrer Mutter Gertrud reizen. Über sie ist ja nicht viel bekannt, und ich hätte sicherlich eine Menge Fragen an sie. Es fiel mir nicht immer leicht, ihre Entscheidungen nachzuvollziehen.
Spannend finde ich außerdem gerade die ambivalenten Figuren wie Elke und ihr SS-Freund. Das hat es ja gegeben: SS-Leute, die geholfen haben, normale Bürger, die Zwangsarbeitern heimlich Essen gebracht haben usw.. Was haben die eigentlich gedacht? Wie haben die sich ihr Handeln vor sich selbst erklärt?
Der Roman umfasst 3 Teile, die unterschiedliche Zeiträume umfassen. Warum haben Sie diese zeitliche Aufteilung gewählt? Wie kommt es zu der Lücke von 1934 bis 1939?
Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 war nicht nur ein radikaler Einschnitt im Leben der Familie Kühlem, sondern aller Deutschen. Sofort danach und gerade in der ersten Zeit wurden Andersdenkende brutal und systematisch ausgeschaltet. Selbst vor Morden schreckte man nicht zurück. Das war auch ein starkes Signal an die restliche Bevölkerung.
Mucki Koch hat als kleines Kind im Elternhaus die unmittelbaren Folgen des Umbruchs hautnah erlebt. Diese Erlebnisse haben sie für ihr Leben geprägt, auch und gerade in ihrer politischen Einstellung und in dem, was sie unter „Widerstand“ verstanden hat. Daher war es mir wichtig, diese Anfangszeit zu schildern.
Darüber hinaus wurde ja auch das Familienleben komplett aus den Angeln gehoben – die Verhaftungen des Vaters, die plötzlich einsetzenden materiellen Nöte. Ein weiterer Schritt in Muckis Entwicklung erfolgte dann bei Kriegsbeginn. Der Krieg hob das Ganze ja noch einmal in eine neue Dimension. Jenseits aller Euphorie, die wir heute nur schwer nachvollziehen können, gab es damals auch viel Angst – berechtigterweise, wie wir heute wissen. Zeitgleich erreichte Mucki das Teenageralter und damit verfestigten sich ihre Positionen.
Ihr Freundeskreis bestand aus unangepassten Jugendlichen, die ähnlich dachten wie sie. Man gab sich Halt untereinander. Aus diesen lockeren Zusammenschlüssen formierte sich dann auch die Gruppe der Edelweißpiraten, der Mucki angehörte.
Wie muss man sich Ihre Recherche zu den Frauen und der damaligen Zeit vorstellen?
Zum einen hat Mucki Koch ja ihre Erlebnisse noch selbst auf diversen Kanälen geschildert. Was über ihre Mutter bekannt ist, weiß ich beispielsweise nur aus ihren Erzählungen.
Zum anderen gibt es natürlich einiges an wissenschaftlichem Material zu den Edelweißpiraten. Das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln hat hier ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Schriften und Sammlungen zum Thema waren wirklich ein unschätzbarer Quell.
Ein Manko ist allerdings, dass diese Forschung – und das Interesse an den Edelweißpiraten generell – leider sehr spät einsetzte. Letztendlich ist dies auch eine Folge des jahrzehntelangen Verdrängungsprozesses, der in Deutschland herrschte. Man wollte sich mit diesen Dingen einfach nicht befassen.
Aber um auf die Frage zurückzukommen: Die Ereignisse, die sich in Köln abspielten, wie beispielsweise der Winterberg-Spangenberg-Prozess, sind ja bekannt. Auch die Geschehnisse in den sogenannten Emslandlagern. In einem von ihnen kam Peter Kühlem ja später nachweislich zu Tode. Ich habe für mich eine Chronologie der Ereignisse erarbeitet und diese beim Schreiben zugrunde gelegt.
Ferner habe ich auf Erfahrungsberichte anderer Frauen, die Verfolgungen ausgesetzt waren, respektive Kommunistinnen, zurückgegriffen. Wichtig war mir vor allem aber auch das Alltagsleben in dieser Zeit, das mir in der bisherigen Aufarbeitung immer viel zu kurz kam. Auch hierzu gibt es aber dankenswerterweise Quellen, die die Erzählungen von Frauen verschriftet und wissenschaftlich eingeordnet haben. Gerade diese Schilderungen der kleinen Freuden und großen Sorgen waren für meine Arbeit sehr wertvoll.
Schön ist übrigens immer, wenn man im Nachhinein noch auf Erzählungen von Erlebnissen stößt, die dem, was man selbst geschrieben hat, sehr nahekommen. Dann weiß man, dass man richtig gelegen hat.